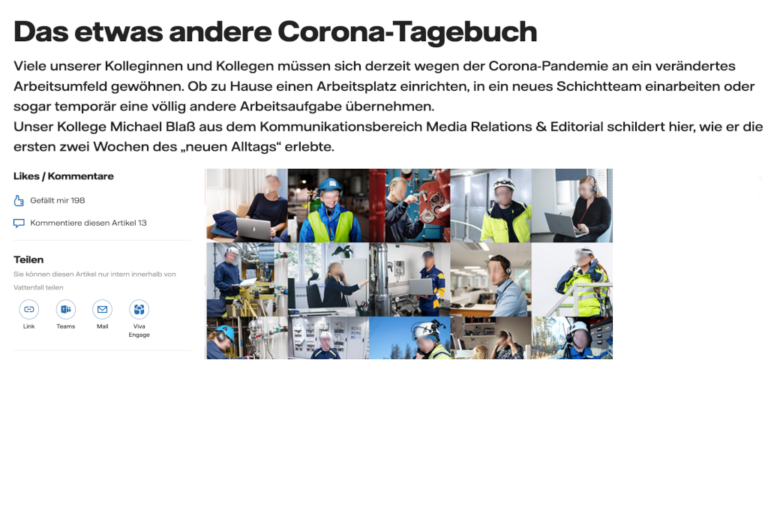Mahlzeit !
Na, alle wieder aus dem Urlaub zurück. Klar, sonst würdet Ihr das ja nicht lesen.
Wer liest schon im Urlaub im Intranet. Ich. Ich hab‘ das gemacht, um nach der letzten Ausgabe zu sehen, ob Ihr wirklich alle weg seid. Und Ihr wart weg. Viele. Deshalb hier nochmal die Erinnerung an Ausgabe 42. Für die Urlauber.
So, kommen wir zur Sache. Wie immer der
Eröffnungsflachwitz
„Möchtest Du einen Kaffee?“
„Hast Du Soja-Milch?“
„Nein.“
„Dann gerne!“
Da ich direkt nach der letzten Ausgabe Urlaub hatte und für die Lesung neue Geschichten geschrieben habe, blieb für diese Ausgabe diesmal wenig Zeit.
Deshalb und weil diese Kolumne natürlich immer einen dienstlichen Bezug haben sollte, erzähle ich hier mal etwas, das ich exakt so früher während der Arbeit erlebt habe.
Damals war’s
Mit 38 Dienstjahren kommt da einiges zusammen. Diese Geschichte ist über 30 Jahre her, damals arbeitete ich für die Bewag als PC-Betreuer. Und wenn Ihr jetzt zurückrechnet, dann war das Anfang der 90er, da gab es keine Handys, jedenfalls keine, die man als einzelne Person tragen konnte, und kein Computer-Netzwerk. Und die Kollegin, die in dieser Geschichte die andere Hauptrolle spielt, dürfte schon lange im verdienten Ruhestand sein. Andere Beteiligte bzw. Mitwisser gibt es nicht, es wird hier also niemand der Lächerlichkeit preisgegeben. Außer ich selbst vielleicht.
Kein Netzwerk bedeutet, jeder und jede, die im Büro arbeitete, hatte eine eigene Blechkiste von der Größe einer Mikrowelle auf dem Schreibtisch, meistens vom Typ Commodore. Darauf ein einfarbiger, Fachbegriff monochromer, meist grüner Monitor. Also nicht der Monitor war grün, der war irgendwas zwischen Ocker und nikotinbraun. Aber die Zeichen auf dem Monitor waren grün. Auf schwarzem Grund. Und meistens war da auch ein Drucker dabei. Verbunden mit einem Druckerkabel. Netzwerk gab es ja noch nicht. Laserdrucker, die damals noch den Preis eines Einfamilienhauses hatten, waren recht selten, daher wurden Tintenstrahldrucker eingesetzt.
Frage an die älteren Leser: erinnert Ihr Euch noch an den HP Deskjet 500? Die Dinger hatten einen halben Liter schwarze Tinte an Bord und waren unverwüstlich. Die konnte man aus dem Fenster im dritten Stock werfen, im Hof dann wieder ein Kabel angesteckt und die haben weitergedruckt. Schwarz, sonst nichts. Nicht wie heute, wo Fehlermeldungen wie „Das Papier ist heute aber ziemlich rauh.“, „Das Tonerpulver ist mir etwas zu grobkörnig.“ und „Was, soviel? Hach, da reicht mein Speicher aber nicht aus.“ zur täglichen Praxis gehören.
Wir hatten eine riesige Werkstatt, Werkzeugkoffer, mehrere Diskettenboxen, quasi eine tragbare Cloud und einen Textpieper, um auf unseren Reparatur-Touren erreichbar zu sein. Handys gab es wie gesagt noch nicht. Und als ich dann mal in der Stauffenbergstr. unterwegs war, tat der Pieper, was er tun soll. Er piepte.
„2.5.13 Drucker“ stand im Display. Mehr ging nicht. Gegen den Umfang einer Pieper-Botschaft wirkt die heutige SMS wie ein Buddenbrooks-Roman. Und wir hatten schon die guten mit Zeichenübertragung. Die einfachen Pieper… piepten. Da musste man zurückrufen und fragen, was los ist.
Ich wusste über meinen nächsten Einsatz also lediglich, dass ein Drucker im Haus 2, 5.Etage irgendwelche Probleme hat. Nix wie hin. Aus meiner Erinnerung müsste dort Frau Meier (Name natürlich aus DSGVO-Gründen verändert) sitzen.
Frau Meier saß, wie damals üblich, allein bzw. maximal mit einer weiteren Person in ihrem Büro. An diesem Tag war sie allein. Als ich eintrat, telefonierte sie. Tischapparat, Hörer am Spiralkabel, keine Chance, sich irgendwie zum Drucker zu bewegen. Ich signalisierte ihr leise, sie solle ruhig zu Ende telefonieren und sah mich um.
Auf den ersten Blick bemerkte ich, dass das Druckerkabel, also die Nabelschnur, die den Drucker mit Daten vom Commodore-Computer versorgte, schief eingesteckt war. Das war selbst für den Deskjet, den Hulk unter den Druckern, zu viel.
Mit einem Handgriff war die Störung behoben.
In diesem Moment endete das Telefonat, Frau Meier kam auf mich zu, begrüßte mich freundlich und erklärte mir, dass der Drucker nicht mehr drucke.
Und anstatt nun, wie es sich für einen vertrauenswürdigen Kollegen gehört, die Kollegin über den bereits bemerkten Fehler aufzuklären, meldete sich mein innerer Kobold.
Ich nickte wissend, legte beide Hände beschwörend auf den Drucker und begann, schamanenhaft die Augen zu schließen und mich zu konzentrieren. Nach einigen, für die Kollegin sehr langen Sekunden beendete ich das Ritual und bat sie mit einem „So, das war’s, alles wieder in Ordnung“, zu drucken.
Ihr Blick war eine Mischung aus „Ist der Typ völlig irre?“ und „Das gibt es doch nicht!“.
Nach einem ergänzenden „Vertrauen sie mir und starten sie einfach einen Testdruck“-Blick setzte sie dann widerwillig den Druck ab.
Und natürlich sprang der Drucker sofort an.
Ob aus Mitleid über die völlige Verwirrung oder aus Angst vor disziplinarischen Maßnahmen kann ich nicht mehr genau sagen, aber ich habe die Kollegin dann am Ende doch aufgeklärt, so wie es sich eben für einen vertrauenswürdigen Kollegen gehört. Nach einigen Minuten. Die ich zugegebenermaßen sehr genossen habe.
Warum erzähle ich diese Geschichte? Nun, zum einen ist mir dies als eine von vielen Episoden über all die Jahre immer im Gedächtnis geblieben, zum anderen muss man nicht immer alles bierernst nehmen. Jedenfalls im Kollegenkreis. Bei Kunden ist das sicher was anderes, aber intern ist mir heutzutage vieles viel zu verbissen. Da wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt und manche sind interne Dienstleister und haben sich entsprechend zu verhalten.
Das hier hat keine Zeit gekostet (bis auf die zwei Minuten am Ende, die die Kollegin gebraucht, ihr Weltbild neu zu sortieren), hat niemandem geschadet, die Aufgabe wurde gelöst und am Ende haben wir beide gelacht. Mission accomplished.
Wenn ich heute beim IT Servicedesk anrufe, weil mein prähistorisches Computerwissen nicht mehr ausreicht, um den Drucker zum Laufen zu bewegen, dann ist für mich mein Gegenüber immer noch ein Kollege und nicht irgendein Dienstleister. Und so behandele ich ihn auch.
Solange er nicht die Hand auflegt.
Nach dem Wort zum Sonntag nun ein Beitrag aus der neuen Reihe
Was ich schon immer nicht wissen wollte
Als ich vor kurzem mal wegen irgendeiner Eilmeldung auf dem Internetportal von n-tv gelandet bin, habe ich etwas weiter gescrollt. Ich weiß nicht mehr, ob es in der Rubrik Ernährung, bei der Wissenschaft oder im Feuilleton war, jedenfalls habe ich diesen Artikel gesehen:

Asseln.
Was sich anhört wie eine Kleinstadt in Niedersachsen, sind in Wirklichkeit kleine, für meine Begriffe ziemlich eklige, aber nützliche Tierchen.
Interessiert und deshalb arglos klickte ich auf die Überschrift und erwartete einen erklärenden Artikel, ein bis zwei Bildschirmseiten lang, mit ein paar Bildern.
Warum schaut man sich einen Artikel über Asseln an? Zumal, wenn man vorher darauf hingewiesen wird, dass das „etwas eklig“ ist. Vorausgesetzt, man ist kein Biologe oder Kammerjäger, der schon alles gesehen hat, möchte man doch höchstwahrscheinlich etwas über diese Tierchen erfahren. Entweder, weil man wissen möchte, wie man die wieder los wird oder warum sie überhaupt da sind. Vielleicht noch, um damit mal den Nachbarn zu ärgern, aber in aller Regel sucht man doch Informationen. Das Letzte, was ich erwarte, sind Tele- bzw. Makroaufnahmen dieser Lebewesen. Wenn ich das sehen möchte, schlage ich die „Enzyklopädie der Tiere“ auf oder ich frage, ob ich mir mal in Kreuzberg die Vorratskammer einer Dönerbude ansehen darf.
Nicht so bei n-tv.

Quelle: www.ntv.de
Eine Bildstrecke mit 51 Bildern, jeweils unterlegt mit einem, maximal zwei Sätzen.
Acht, ich habe sie alle durchgeklickt und gezählt, sind nicht unmittelbar eklig. Sie zeigen lediglich Spaten, nasse Erde und einen Vogel, der hier als Fressfeind vorgestellt wird. Verhältnismäßig harmlos also. Aber die anderen 43 haben es in sich.
Auf Twitter / X gibt es Triggerwarnungen. Die weisen einen darauf hin: „Achtung, sensible Inhalte. Willst Du wirklich gucken, dann klicke nochmal extra.“
Bei n-tv: Klick und man schaut einer 20 cm großen Assel direkt ins Gesicht. Schafft man es noch, die jeweiligen Bildunterschriften zu lesen, erfährt man, was mit deren Ausscheidungen geschieht, woraus sie bestehen und warum das für den heimischen Gartenboden gut ist. Und man lernt, dass es über 3.700 Arten gibt. Und das sind nur die, die an Land leben. Zum Glück haben es nur 50 davon nach Deutschland geschafft.
Erst ganz am Ende, ab Bild 48, kommt die entscheidende Info. Wer die Tierchen loswerden möchte, sollte Kehrblech und Besen nutzen. Ach was. Der Geheimtipp folgt mit dem letzten Bild: „Ausgestreutes Zimtpulver oder Backpulver mögen die Tiere mit den 14 Beinen nicht und halten sich deshalb fern.“.
Genug erfahren, da scrolle ich dann doch lieber weiter in den Politikteil zur letzten Rede unseres Gesundheitsministers.
Denn auf die nächste Bildstrecke „Diarrhoe – so kommen sie durch die schlimmsten Stunden“ habe ich mich dann doch nicht mehr getraut zu klicken.
So, keine Ahnung, wie Ihr diese Bilder wieder aus dem Kopf bekommt. Vielleicht denkt Ihr an Eure Urlaubsbilder. Da gibt es hoffentlich merkliche Unterschiede.
Vor dem Schlusswort für heute noch ein ganz kurzer
Flacher:
Ich falle gerne mit der Tür ins Haus – Thomas, 45, SEK-Einsatzleiter
Wie schon ganz am Anfang erwähnt, würden sich Ariane, Dirk und ich wahnsinnig freuen, Euch zu unserer ersten Lesung am 18.9. zu sehen. Der Eintritt ist natürlich frei, das Ganze ist von Kollegen für Kollegen. Keine Dienstleistung. Ihr dürft sogar Fotos machen. Nur Tele- und Makroobjektive sind verboten. Aus Gründen.